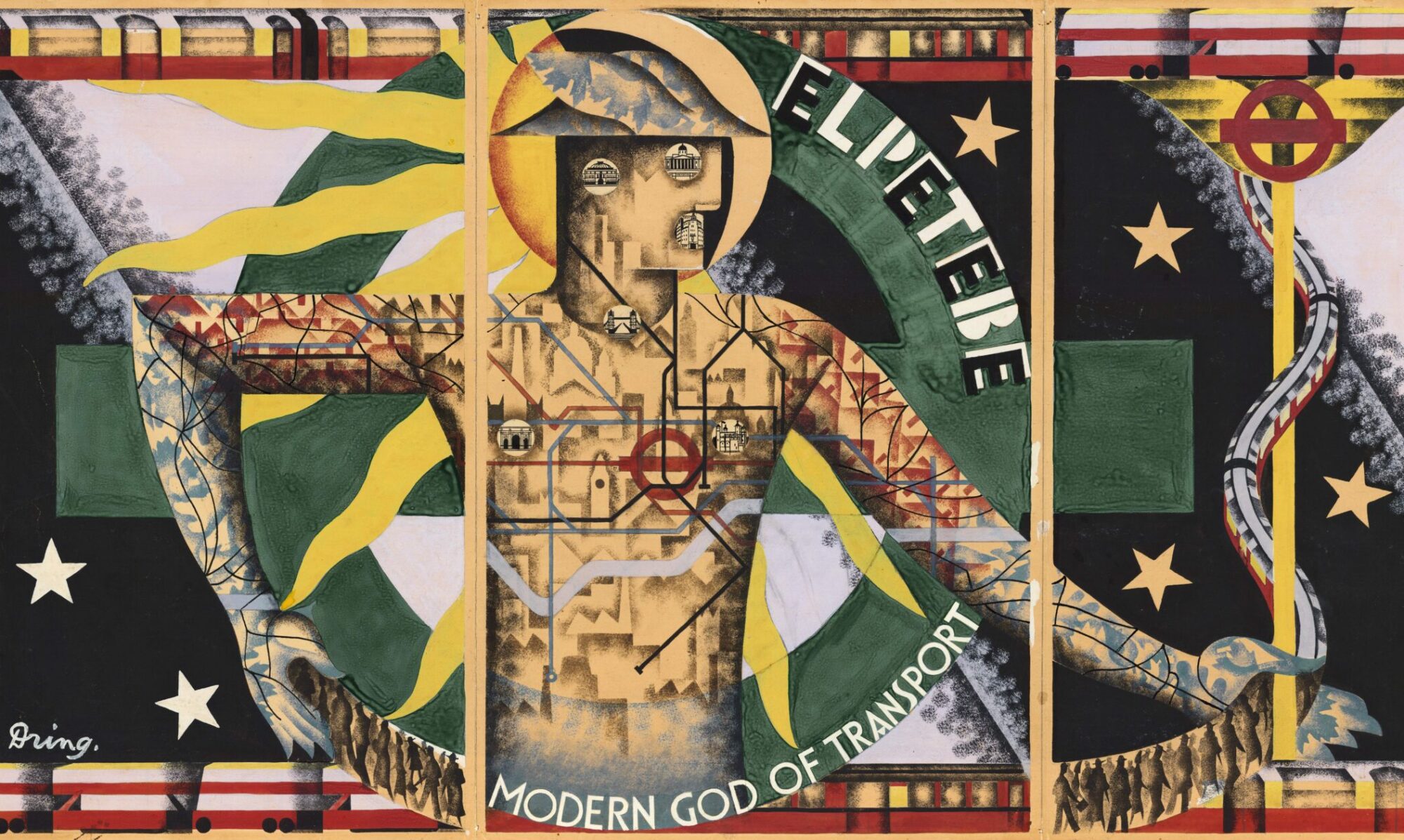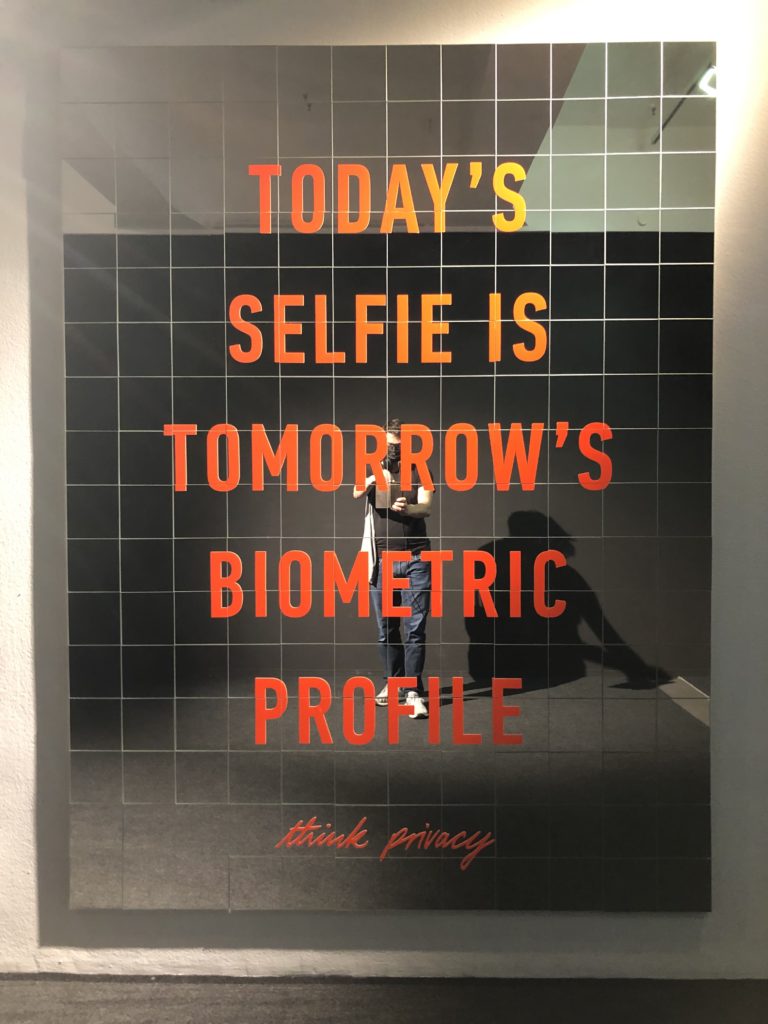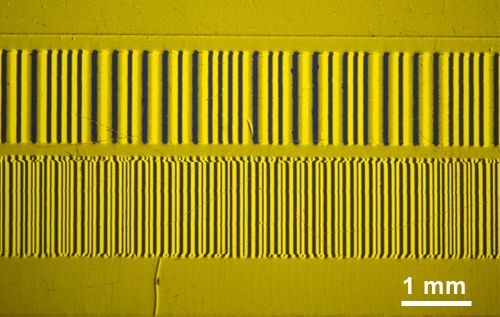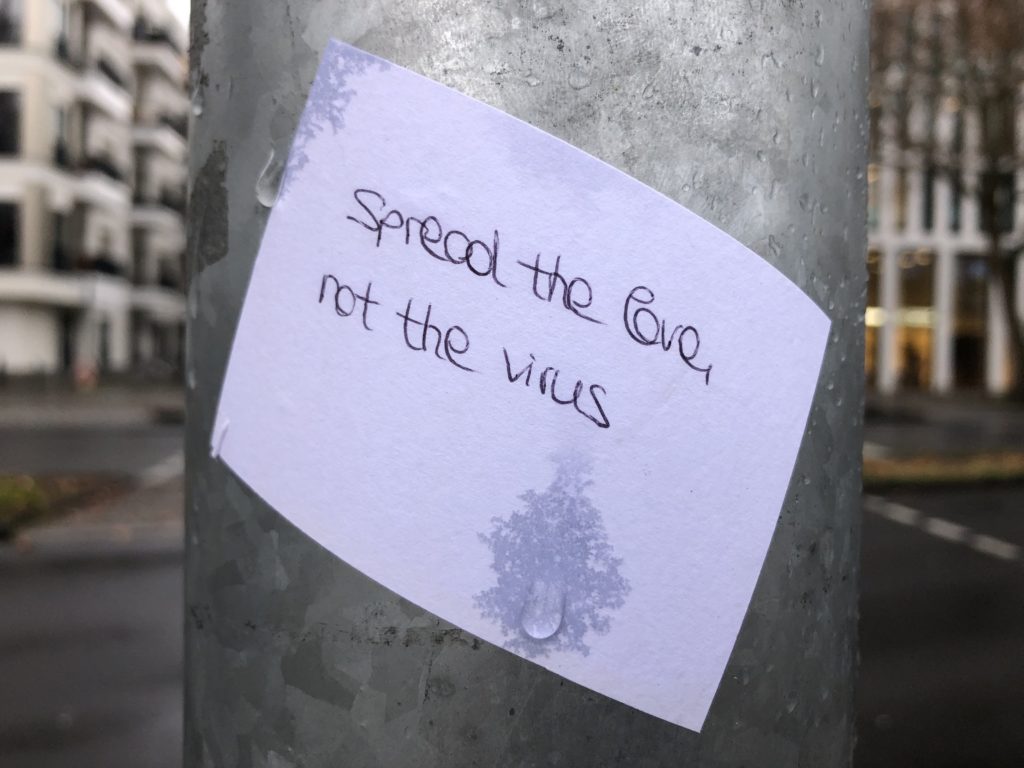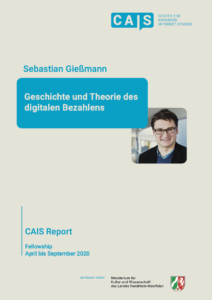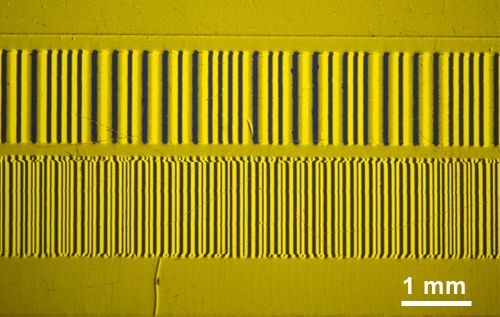
In Michel Serres’ 1989 erstmals erschienenen Elementen einer Geschichte der Wissenschaften steht der Computer am Ende einer Vielzahl von Verzweigungen im Netz aller möglichen Wissens- und Wissenschaftsgeschichten. Seine Bedingung liegt dabei nicht nur in allen Netzwerken, die ihm vorausgehen. Serres lässt keinen Zweifel daran, dass der Computer zu jenen Maschinen gehört, die man Universalwerkzeuge nennt – „da sie vom Werkzeug die Effizienz und vom Universellen die Wissenschaftlichkeit geerbt haben“.[1] So weit, so vertraut, könnte man mit etwas zu viel Gewissheit meinen: Rechenmaschinen sind eben spätestens seit Turings tape als universelle Maschinen konzipiert worden. Aber bereits Serres stellt nicht die Philosophie und Mathematik des Rechnens mit symbolischen Maschinen in den Vordergrund: Weder Leibniz und Pascal, noch Turing und von Neumann hätten die Rechenwerke komplett im Kopf gehabt, bevor sie sich ihrer konkreten Realisierung widmeten. Im Gegenteil hält Serres hier die praktische Realisierung des Digitalrechners durch Forschung hoch:
„Wer forscht, weiß nicht, sondern tastet sich vorwärts, bastelt, zögert, hält seine Entscheidungen in der Schwebe. Nein, er konstruiert den Rechner von übermorgen nicht dreißig Jahre vor seiner Realisierung, weil er ihn nicht voraussieht; während wir, die ihn kennen und fortan benutzen, leicht dem Fehlschluß erliegen, er hätte ihn vorausgesehen. In Wirklichkeit ist es mit ihm wie mit allen Akteuren dieses Buches – den individuellen und den kollektiven, den materiellen wie den intellektuellen: sie sind nur Darsteller seiner Verzweigungen und seines schwankenden Netzes.“[2]
„Die einstmals universelle Maschine“ weiterlesen